Ausstellungen sind ein Mittel, um geschlechterhistorische Inhalte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch was bedeutet es – vor dem Hintergrund der Männerdominanz in Geschichtswissenschaft und Museum – feministisch zu kuratieren?

Unter einer Treppe stehen dicht gedrängt Haushaltsgeräte und Küchenmöbel. Was auf den ersten Blick wie ein Sammelsurium an Alltagsgegenständen scheint, ist die 1985 eröffnete Küchenausstellung im Berliner Technikmuseum. Zuvor wurde eine neue Sammlungskonzeption erarbeitet, die die Produktions- durch die Haushaltstechnik erweiterte. Im Vergleich zum Platz, den vermeintlich ‚männliche‘ Objekte wie Autos oder Maschinen zur Energieerzeugung einnahmen, war ihre Ausstellungsfläche lächerlich klein. Sogar von ihren Kuratorinnen wurde die Präsentation alles andere als ideal angesehen und als „Treppenwitz” bezeichnet.[1] Aber aus Perspektive des feministischen Kuratierens erfüllt sie gleichzeitig einen wichtigen Zweck: Sichtbarkeit.
Sprung ins Jahr 2023: (Technik-)Museen sind nicht mehr nur Männerdomäne. Heute gibt es in den meisten Technikmuseen Sammlungen und Ausstellungen zu Alltags- und Haushaltstechnik. Auch im allgemeinen Museumsdiskurs ist die Notwendigkeit, sozialhistorische und intersektionale Dimensionen von Ausstellungsthemen zu berücksichtigen, grundsätzlich angekommen.[2]
Gleichzeitig werden in Museen immer noch sexistische Vorstellungen von Geschlecht re_produziert. Sexismus äußert sich auf individueller, institutioneller und struktureller Ebene. In Ausstellungen etwa in Form von Machtverhältnissen zwischen den Beteiligten, aber auch auf Ebene der Themen- und Objektwahl, die Geschlechterklischees zementieren können. Je nach Beschaffenheit des Ausstellungskontextes gibt es für Kurator*innen unterschiedliche Möglichkeiten, feministisch zu handeln.[3]

Im Technischen Museum Wien beschäftigt sich etwa die von Roswitha Muttenthaler kuratierte dauerhafte Präsentation „Geliebt – gelobt – unerwünscht” explizit mit Haushaltstechnik. Die Ausstellung zeigt, neben konsumhistorischen Kontexten, wie sich die Vergeschlechtlichung von Hausarbeit in vermeintlich ‚geschlechtslosen‘ Dingen und ihren Gebrauchsanleitungen manifestiert.
Was ist feministisch Kuratieren?
Gleich vorweg: Auf die Frage, was Kuratieren zum feministischen Kuratieren macht, gibt es aus unserer Sicht keine eindeutige Antwort. Den Begriff „feministisch” verstehen wir dabei als umbrella term für geschlechtersensible Ausstellungsweisen, die sich bewusst gegen den patriarchalen Status quo positionieren und versuchen, Sexismen nicht zu re_produzieren.
Dass diese Positionierung mal offensichtlicher und mal unscheinbarer sein kann, zeigt das eingangs genannte Fallbeispiel aus dem Deutschen Technikmuseum. Es steht paradigmatisch für die Möglichkeiten, aber auch Fallstricke des feministischen Kuratierens. Denn das von Joan W. Scott treffend beschriebene Paradox der Differenz[4] wirkt auch im Ausstellungsraum.
Die Ambivalenz des Sichtbarmachens
Wenn wir uns in Ausstellungen für das explizite Zeigen von ‚Frauengeschichte‘ und dem Erzählen von Formen der Diskriminierung entscheiden, bewegen wir uns innerhalb der binären Geschlechterlogik, wodurch diese reproduziert wird. Erzählen wir sie hingegen nicht, laufen wir wiederum Gefahr, die androzentrische Geschichtsauffassung fortzuschreiben und vergeschlechtlichte Ungleichheit zu verschweigen. Dem Bewusstsein für diese grundlegende Ambivalenz liegt auch unsere Entscheidung zugrunde, in diesem Text die binäre und die queere Schreibweise mit dem Genderstern zu nutzen, d.h. nicht einheitlich zu gendern.[5]
Sowohl dem Sichtbarmachen und Erzählen, wie auch dem Nicht-Zeigen und Nicht-Erzählen können demnach feministische Intentionen zugrunde liegen. Feministische Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Kurator*innen haben verschiedene Wege gefunden, um sich diesen Aufgaben anzunehmen.
Dieser Beitrag kann daher keine monodirektionale Handlungsanweisung sein. Vielmehr skizzieren wir – mit Fokus auf kultur- und geschichtswissenschaftliche Ausstellungen – ein Handlungsfeld mit Anknüpfungspunkten für feministische Interventionen im Museum. Die Handlungsmöglichkeiten des feministischen Kuratierens sind dabei bis heute von der historischen Männerdominanz in Wissenschaft und Museum beeinflusst.

Männerdominanz in Wissenschaft und Museum
Das moderne Museum formierte sich im 19. Jahrhundert und war mit der Herausbildung eines nationalen Selbstverständnisses und der Ausdifferenzierung und Institutionalisierung der wissenschaftlichen Disziplinen verknüpft.[6] Es ist nur naheliegend, dass Museen als Bewahrungs-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen mit Erziehungsfunktion maßgeblich von jenem Wissen geprägt waren bzw. sind, welches sie sammeln und vermitteln.
Die in der Geschichtswissenschaft vorgenommene Selektion von Dingen und Schriftstücken in wichtig (‚männlich‘) und unwichtig (‚weiblich‘) wirken sich auch auf die materiellen Überreste in Archiven und Museen aus, die uns heute als ‚Quellen‘ zur Rekonstruktion der Vergangenheit dienen.[7]
Die Notwendigkeit geschlechterhistorischer Forschung und Sammeltätigkeit sowie das Bewusstsein über die eingeschränkte Quellenlage sind daher Prämissen für feministisch-kuratorische Handlungsmöglichkeiten, die wir im Folgenden skizzieren.
Handlungsfelder
Mit der Kunstwissenschafterin Beatrice von Bismarck denken wir Ausstellen als kulturelles Handlungsfeld, durch das Kunst und Kultur öffentlich werden.[8] Durch den Akt des Ausstellens ist es möglich, gesellschaftliche Verhältnisse festzuschreiben, also zu reproduzieren. Gleichzeitig können Verhältnisse auch als veränderbar gezeigt und damit neues Wissen produziert werden. Das gibt Ausstellen ein hohes machtkritisches Potenzial, das über bloßes Zusammenstellen von Objekten hinausgeht.
Im folgenden Überblick zu relevanten Handlungsräumen für feministisches Kuratieren beziehen wir uns auf den Bereich der kulturhistorisch-geschichtswissenschaftlichen Ausstellungen, etwa in Universal- oder historischen aber auch ethnologischen Museen. Wir beziehen uns explizit nicht auf Kunstausstellungen oder dezidiert feministische Räume, wie etwa Frauen*museen.
1. Zurückschauen

Feministisches Kuratieren und das Schreiben darüber ist nicht neu und entwickelt sich permanent weiter.[9] Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigten sich Sonderausstellungen mit den Werken von Frauen*. Ab den 1970er Jahren kam es zur Gründung von autonomen Frauen*museen[10], aber auch zur Einrichtung von ‚Frauenecken‘ wie im Deutschen Technikmuseum. Feministische Kunst setzte sich mit den Ambivalenzen der Sichtbarkeit von Frauen* auseinander und entwickelte neue Formen und Settings des Ausstellens. Wenngleich Feminist*innen heute zum Teil vor anderen Voraussetzungen stehen und sich intersektionale Ansätze verbreitet haben, können wir viel von früheren Formen des feministischen Kuratierens (und auch aus seinen Fehlern) lernen.
Das Projekt „Womanhouse” gilt etwa als Meilenstein der feministischen Kunst. 1972 gestalteten Künstlerinnen unter der Leitung von Judy Chicago and Miriam Schapiro im Zuge des Feminist Art Program des California Institute of the Arts in Los Angeles kollektiv die Zimmer einer leerstehenden Villa zu feministischen Installationen und Performanceräumen um.
2. Das Format wählen
Feministisch-kuratorische Handlungen stehen in Wechselwirkung zum Ausstellungsformat. Die Präsentation feministischer Inhalte in Dauerausstellungen (etwa durch Themenschwerpunkte) hat den Vorteil, Inhalte längerfristig und nachhaltig im Museum zu verankern. Gleichzeitig bringt das Format die Problematik des Festschreibens mit sich und kann aufgrund des Einflusses von Entscheidungsträger*innen (etwa Geldgeber*innen) an Radikalität verlieren. ‚Flüchtige‘ Formate, wie Sonderausstellung oder temporär begrenzte Interventionen haben oft den Nachteil, mangels umfassender Dokumentation (etwa einem Katalog) kaum Spuren im öffentlichen Gedächtnis zu hinterlassen. Gleichsam ist der inhaltlich-kuratorische Handlungsspielraum in temporär begrenzten Formaten oft größer. Insbesondere Interventionen haben darüber hinaus einen stark dissidenten Charakter, der nützlich sein kann, um auf Problematiken hinzuweisen und Auseinandersetzungen anzuregen.[11]

2022 intervenierten Studentinnen in die Kücheninszenierungen der Bezirksmuseen Favoriten (Foto), Floridsdorf und Liesing. Die Intervention „Frauen(t)räume?” thematisiert geschlechtsspezifische Ungleichheit im Museum und in der Gesellschaft um 1900. Die temporär geplanten Eingriffe wurden mittlerweile von allen beteiligten Museen dauerhaft übernommen.[12]
3. Intersektionale Teams und Netzwerke organisieren
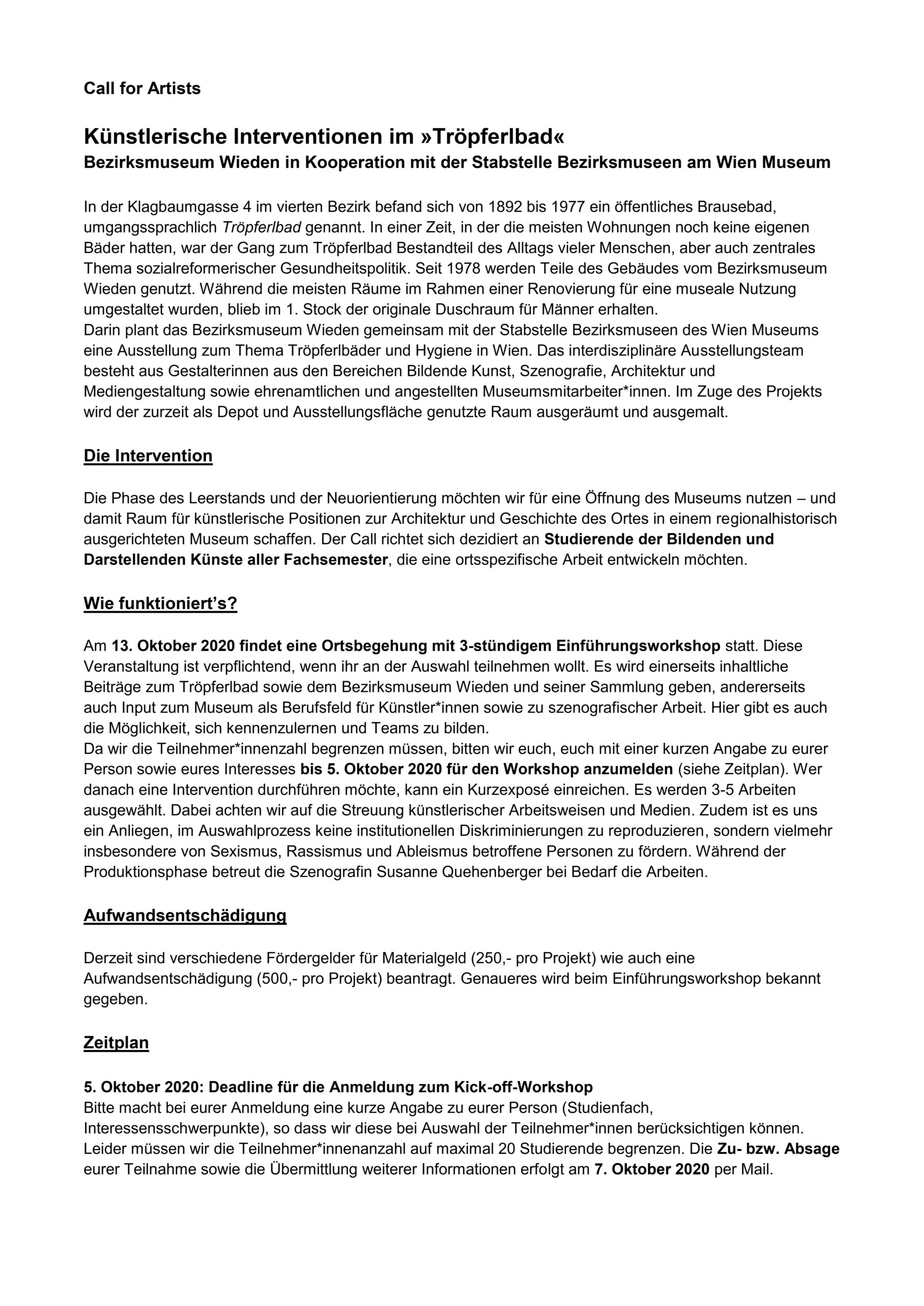
In manchen Fällen können Kurator*innen die Zusammensetzung ihres Ausstellungsteams beeinflussen, etwa durch die Wahl von Gestaltungsbüros. Ist die personale Struktur einer Institution wenig divers, kann das Einladen von externen Personen neue Perspektiven und Expertisen in eine Ausstellung bringen. Oft ist es für Externe auch einfacher, neue Inhalte vorzuschlagen und durchzubringen, die sich im Idealfall nachhaltig in der Institution niederschlagen. Umgekehrt kann die Zusammenarbeit mit Externen aber auch instrumentalisierend und ausbeutend sein. Um dem entgegenzuwirken, ist es lohnend, Netzwerke zu bilden. Sich über Ideen, Inhalte, Probleme und Ziele auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen ist im von Konkurrenz geprägten Wissenschafts- und Kultursektor ein feministisch-solidarischer Akt.[13]
Die Arbeitsteilung im ehrenamtlichen Team des Bezirksmuseums Wieden war stark vergeschlechtlicht: Männer* kuratieren, Frauen* erledigen administrative und reproduktive Tätigkeiten. Um sie mit neuen Perspektiven vertraut zu machen, wurden 2020 Kunststudierende über einen Open Call für Interventionen eingeladen. Diese brachten nicht nur (zum Teil) feministische Kunst, sondern transportierten auch ein feministisches Verständnis von Arbeitsteilung ins Museum.
4. Perspektive einnehmen
Ein*e Kurator*in entscheidet sich für spezifische Themen oder Narrative. So können sich ganze Ausstellungen feministischen Bewegungen selbst widmen, wie etwa die Ausstellung “Sie meinen es politisch!” über Kämpfe um das Frauenwahlrecht im Volkskundemuseum Wien (2018). Geschlechtssensible Themenwahl kann aber auch bedeuten, spezifische Foki innerhalb einer Ausstellung (zu jedem beliebigen Thema) zu setzen. Über geschlechtsspezifische Fragestellungen oder die Erweiterung des narrativen Rahmens kann eine Ausstellung feministisch geprägt werden.

Das Narrativ der Ausstellung „Vor Schand und Noth gerettet?!” zum Wiener Gebär- und Findelhaus im Bezirksmuseum Josefstadt endete nicht mit der Auflösung der beiden präsentierten Institutionen, sondern mit Kämpfen um reproduktive Gerechtigkeit bis heute. Dadurch wurde feministischen Forderungen Raum gegeben.
5. Inszenierung nutzen

Ausstellungen sind keine Bücher an der Wand, sondern zeigen miteinander kommunizierende Objekte, Bilder, Texte und audiovisuelle Medien. Bei der Inszenierung einer Ausstellung ist eine zentrale Frage, was Besucher*innen in einer Ausstellung erfahren und wie, bzw. worauf ihre Aufmerksamkeit gelenkt wird: Wer oder was wird ins Zentrum gerückt oder auf einen Sockel gestellt? Wer bekommt wie viel und welchen Platz in der Ausstellung? Zudem kann Inszenierung ein Mittel sein, um – abseits von Text und Objekten – gestalterisch auf die Kategorie Geschlecht hinzuweisen. Sie kann Leerstellen markieren oder diskriminierende Darstellungen brechen, indem kuratorische Eingriffe vorgenommen und sichtbar gemacht werden.
In der Ausstellung „Im Tröpferlbad” im Bezirksmuseum Wieden wird das intime Thema „Körperhygiene heute” über Audiocollagen von Interviews mit 25 Wiener*innen vermittelt. Auszüge sind als Zitate an die Wand geklebt oder in körpernahe Textilien eingenäht. Insbesondere bei Statements zu Privatheit und Öffentlichkeit wurden geschlechtsspezifische Machtverhältnisse deutlich.
6. Objekte auswählen

Objekte sind meist die zentralen Inhalte einer Ausstellung. Auch sie sind vergeschlechtlicht. Um stereotype Zuschreibungen nicht zu reproduzieren – oder aber explizit auf sie hinweisen – empfiehlt es sich, Geschlecht berücksichtigende oder noch besser intersektionale Fragestellungen bereits in den Auswahlprozess miteinzubeziehen. Auch hier sind wieder An- und Abwesenheit sowie Sichtbarkeit von Bedeutung: Wer hat das Objekt aus welchem Grund hergestellt? Wer hat es benutzt? Was re_präsentiert es in meiner kuratorisch gesetzten Erzählung und welchen Stellenwert bekommt es? Welche Assoziationen kann es nahelegen? Ist es Leitobjekt oder eine Illustration am Rande? Bei Objekten mit Abbildungscharakter wie etwa Fotografien ist außerdem die Frage relevant, wie Frauen* und Männer*, bzw. welche Geschlechterformationen darin gezeigt werden. Die Gegenfrage – Was möchte ich gerne nicht zeigen? – ist ebenfalls ein hilfreiches Werkzeug.[14]
Das Bild zeigt eine Badeschürze in der Ausstellung „Im Tröpferlbad”. Hier zeigt sich die feministische Themensetzung in der Auswahl der Fragen, die zur Wiener Hygienegeschichte gestellt werden. Der Zusammenhang von Geschlecht und Hygienegeschichte wird etwa über Kleidungsvorschriften und die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Größe der obligatorischen Badeschürzen in historischen Tröpferlbädern aufgegriffen.
7. Sprache und Text einsetzen

Text erfüllt in Ausstellungen mehrere Funktionen: Er erklärt, informiert, kontextualisiert, wird gestalterisch eingesetzt und bildet einen narrativen Rahmen, an dem sich Besucher*innen orientieren können. Text kann auch eine Möglichkeit sein, Brüche und Irritation zu erzeugen. Beispielsweise können geschlechtsspezifische Fragen an Objekte gestellt werden, bei denen dies auf den ersten Blick nicht erwartet wird. Als Kurator*in kann man sich zudem für eine geschlechtersensible Schreibweise entscheiden und in der Ausstellung transparent machen, warum welche Form des Genderns gewählt wurde.
In der Ausstellung „Vor Schand und Noth gerettet?!” im Bezirksmuseum Josefstadt wurde ein Hebammenkoffer gezeigt. Im zugehörigen Text wurde das Objekt geschlechtssensibel kontextualisiert. An anderer Stelle in der Ausstellung fand sich eine Erklärung, warum in der Ausstellung binär gegendert wird.
Wie diese fragmentarische Aufzählung an Handlungsfeldern zeigt, kann sowohl im Großen als auch im Kleinen geschlechtssensibel-feministisch im Ausstellungsraum interveniert werden. Trotz aller benannter möglicher Fallstricke, die sich dabei ergeben, möchten wir abschließend für Fehlerfreude plädieren. Feministisches Kuratieren entwickelt sich permanent weiter und ist ein nicht abschließbarer Prozess. Museale Baustellen gibt es ohne Ende. Möglichkeiten, an diesen zu arbeiten, sind vielfältig. Die Ergebnisse gefallen nicht immer allen und schließen auch nie alle[15] ein. Aber sie bieten ein Fundament für Diskussion und Weiterentwicklung!
Anna Jungmayr & Alina Strmljan
Anmerkungen
[1] In einem Rückblick zeigt die Technikhistorikerin und Kuratorin Gabriele Wohlauf die Entwicklung geschlechterhistorischer Arbeiten im Deutschen Technikmuseum in Berlin (ehemals Museum für Verkehr und Technik), in die sie selbst involviert war, was den Text zu einer besonders wertvollen Quelle für feministisches Kuratieren macht. Vgl. Gabriele Wohlauf: „Rin in die Bude mit der Frau!“ – Die Geschlechterfrage im Berliner Technikmuseum 1980-2006, in: Daniela Döring, Hannah Fitsch, Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung TU Berlin (Hg.innen): GENDER TECHNIK MUSEUM: Strategien für eine geschlechtergerechte Museumspraxis, Berlin 2016, S. 43f., online unter: http://www.gendertechnikmuseum.de/downloads/03_GTM_Wohlauf-Rin-in-die-Dinger.pdf (16.03.2023).
[2] Diese Entwicklung spiegelt sich rezent in der Diskussion über die Museumsdefinition von ICOM, aber auch in den Museen selbst wider. Etwa im Technischen Museum Wien gibt es mit der Ausstellung „Geliebt – gelobt – unerwünscht” seit 2018 eine dauerhafte Präsentation von Haushaltstechnik, vgl. die zugehörige Publikation: Roswitha Muttenhaler: Haushaltstechnik zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Wien 2020. Vertiefend zur Debatte über die Museumsdefinition vgl. Museological Review: What is a museum today?, Issue 24, 2019 – 2020.
[3] Zu den unterschiedlichen Bedeutungen, Aufgaben und Handlungsspielräumen hinter den Begriffen „Museum”, „Sammlung”, „Ausstellung” und „Kurator*in” vgl. Anke te Heesen: Theorien des Museums zur Einführung, Hamburg 2013, S. 18-29.
[4] Vgl. Joan Wallach Scott: Only Paradoxes to Offer, Cambridge 1996, S. 3f.
[5] Zur Bedeutung unterschiedlicher Sprachformen vgl. Hannah Witte: Typohacks. Handbuch für geschlechtersensible Sprache und Typografie, Frankfurt am Main 2021; AG Feministisch Sprachhandeln der Humboldt-Universität zu Berlin: Was tun? Sprachhandeln – aber wie? W_Ortungen statt Tatenlosigkeit, Berlin 2014/2015; lann hornscheidt: feministische w_orte. ein lern-, denk- und handlungsbuch zu sprache und diskriminierung, gender studies und feministischer linguistik, frankfurt a. main 2012.
[6] Vgl. Lisa Spanka: Vergegenwärtigungen von Geschlecht und Nation im Museum. Das Deutsche Historische Museum und das Dänische Nationalmuseum im Vergleich, Bielefeld 2019, S. 17 und S. 55-57; allgemeiner vgl. Tony Bennett: The Birth of the Museum. History, Theory, Politics, London/New York 1995.
[7] Sammlungen und Archive, wie etwa die Sammlung Frauennachlässe der Universität Wien oder das STICHWORT – Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung nehmen sich dieser Aufgabe an und können in ihrem Nutzen für geschlechtersensible Ausstellungen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch an Museen, wie etwa dem Alpinen Museum Bern, wird mit einem Fokus auf Geschlecht „nachgesammelt”, um Leerstellen der Sammlung zu schließen. Im Rahmen des „Fundbüros für Erinnerungen“, einem öffentlichen Aufruf, ergänzt es die eigene Sammlung um Objekte und Geschichten von „Frauen am Berg”.
[8] Vgl. Beatrice von Bismarck: Das Kuratorische, Leipzig 2021, S. 13-15.
[9] Ein zentrales Werk zum feministischen Kuratieren im deutschsprachigen Raum ist etwa: Gerlinde Hauer/Roswitha Muttenthaler/Anna Schober/Regina Wonisch: Das Inszenierte Geschlecht. Feministische Strategien im Museum, Wien 1997.
[10] Zur Praxis und Geschichte von Frauen*museen und -archiven vgl. Jürgen Bacia, Cornelia Wenzel: Bewegung Bewahren. Freie Archive und die Geschichte von unten, Berlin 2013, S. 51-73; Elke Krasny/Frauenmuseum Meran: Women’s:Museum. Curatorial Politics in Feminism, Education, History, and Art, Wien 2013.
[11] Anna Jungmayr/Alina Strmljan: Uni im Bezirksmuseum – Stören als produktiver Prozess, in: neuesmuseum (01-02/2023), S. 14-17, online unter https://doi.org/10.58865/13.14/2312.
[12] Die Intervention war ein Ergebnis des Projekts „Uni im Bezirksmuseum” – Eine Kooperation der Stabstelle Bezirksmuseen im Wien Museum mit den Historikern Florian Wenninger und Peter Autengruber am Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien, vgl. Jungmayr/Strmljan, Uni im Bezirksmuseum.
[13] Für einen sehr detailliert und praxisnahen ausgeführten Bericht zur Bedeutung von feministischen Netzwerken in Museum und Forschung vgl. Wohlauf, „Rin in die Bude mit der Frau!“.
[14] Diese Aufzählung ist sehr beschränkt. Die Wissenschaftsforscherin Smilla Ebeling hat in ihrem Leitfaden „Museum und Gender” viele weitere hilfreiche Leitfragen formuliert. Vgl. Smilla Ebeling: Museum & Gender. Ein Leitfaden (= Neue Heimatmuseen, Bd. 2), Münster/New York 2016, online unter: https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&buchnr=3403 (26.03.2023).
[15] Auch der Museologe Gottfried Fliedl betont, dass es kein Museum für alle geben kann. Vgl. Gottfried Fliedl, Zwölf Möglichkeiten, das Museum mißzuverstehen. Erweiterte Fassung des in Neues Museum erschienen Textes, in: Ders. (Hg.): museologien, Blog, 04.06.2023, online unter:https://museologien.blogspot.com/2018/06/zwolf-moglichkeiten-das-museum.html (16.03.2023).






Kommentar schreiben